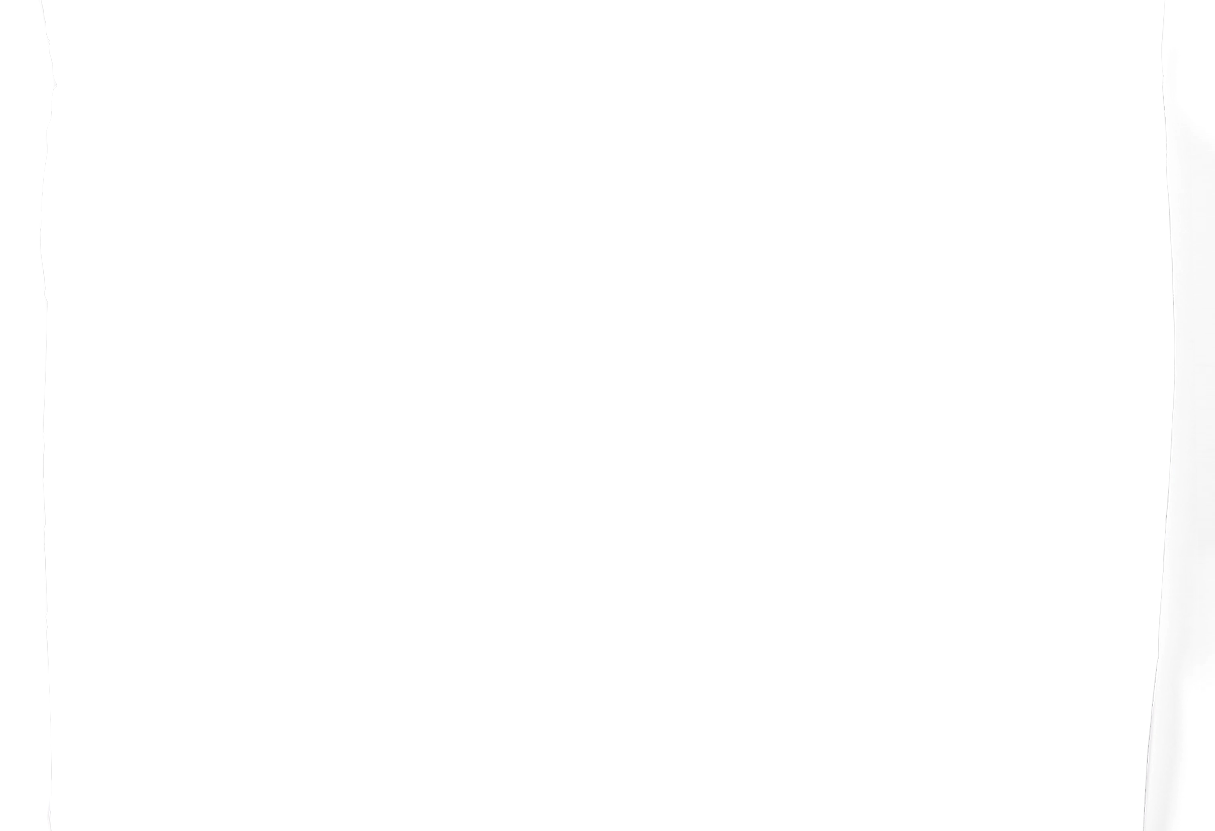Ein Exkurs mit Michael von Brück zu Themen unserer Spielzeit
Michael von Brück ist Professor für Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München und praktiziert den Zen-Buddhismus.
Eva-Maria Voigtländer: Herr von Brück, Sie sind selbst evangelisch, sogar ordinierter Pfarrer. Seit vielen Jahren aber auch und besonders praktizierender Zen-Buddhist. Was ist das Besondere des Buddhismus, das Sie bewogen hat, sich nicht nur wissenschaftlich, sondern auch persönlich mit dieser Weltanschauung zu befassen, d.h. sie sogar zu praktizieren?
Michael von Brück: Das, was mich besonders am Buddhismus interessiert, ist in der Tat die Praxis. Und diese Praxis ist es, die vielleicht auch schon unsere großen Vorfahren im Westen im 19. Jahrhundert bewogen hat, sich dem Buddhismus zuzuwenden. Und diese Praxis hat – wie mir scheint – zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es das Nichtanhaften an äußeren Dingen, an Dingen des alltäglichen Lebens, am Materiellen. Auf der anderen Seite ist es das Nichtanhaften an Begriffen, an Vorstellungen und an geistigen Konzepten. Dieses Anhaften an geistigen Vorstellungen, das ist die große Verführung in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte der Religionen – dass man sich eben doch ein Bild macht. Eigentlich verbietet es das Mosaische Gesetz zwar schon, aber wir machen uns doch immer wieder Bilder.
Wir sind natürlich auch abhängig von Bildern, und das Bild ist der Inbegriff der emotionalen Bindung, in der alle Voraussetzungen und Chancen fürs Leben liegen, und nicht zuletzt ist das Bild gerade auch dem Künstler natürlich Voraussetzung für seine Arbeit. Aber hier läuft der Künstler zugleich immer Gefahr, das Bild für die Sache selbst zu nehmen. Und da ist der Buddhismus sensibel und diese Praxis öffnet eine spirituelle Weite und letztlich auch eine Weite des Ausdrucks. Das war sicherlich auch ein Grund für Richard Wagners Faszination für die buddhistische Praxis, mit der eine Weite des Ausdrucks nicht nur gedacht, sondern auch erprobt werden kann.
Ein weiterer wichtiger Aspekt im Buddhismus ist die Meditation und damit einhergehend die Öffnung des Bewusstseins für eine Weite, für eine Einsicht. Buddhistische Meditation ist nichts Verschwommenes und ist auch nichts Gefühlsseliges, sondern ist eine Einsicht in einen tieferen Zusammenhang der Wirklichkeit, wie er von Leuten wie Arthur Schopenhauer und eben auch Richard Wagner nachempfunden werden konnte durch die Musik. Es ist kein Zufall, dass Schopenhauer mit seiner – wie soll ich sagen – Begeisterung nicht nur für buddhistisches, sondern überhaupt für indisches Denken, gleichzeitig eine Musikphilosophie entwickelt hat, und das hängt natürlich alles zusammen. Das Zusammenhängende ist dies, dass in der Musik gleichzeitig ausgedrückt werden kann, was in der Sprache nur nachzeitig ist.
Adorno hat diese musikalische Qualität sehr schön auf den Begriff gebracht: In der Melodie bestimmt nicht nur der vorangehende Ton den nächsten, sondern das, was kommt, was also in der Erwartung eines nächsten Tons da ist, prägt schon und qualifiziert den jetzigen Ton. Das heißt also, die Vergangenheit prägt die Gegenwart, die Zukunft prägt die Gegenwart, so dass im Ton, im Klang des Jetzt eine Tiefenerfahrung gemacht werden kann, wie sie in anderen Künsten wahrscheinlich so nicht möglich ist.
EMV: Der Begriff des Jetzt ist sowohl für die Kunst als auch für das Daseinsverstehen des Buddhismus ein zentraler Begriff. Können Sie dieses buddhistische Jetzt noch etwas klarer fassen?
MVB: Das ist nirgends so schön und deutlich gedacht worden wie vom großen Zen-Meister und buddhistischen Denker, Philosophen, auch Künstler Dogen. Dogen lebte im 13. Jahrhundert, ungefähr zeitgleich zur großen dominikanischen Mystik in Europa und zu Meister Eckhart. Dogen hat als einer der wenigen in der Zen-Tradition tatsächlich philosophische Gedanken geformt. Normalerweise ist man im Zen mit Sprache sehr zurückhaltend, man pflegt eine eher bildhafte, poetische Sprache wie in der Dichtkunst. Grundsätzlich ist ja Sprache dann problematisch, wenn sie die Dinge zu deutlich sagen will und meint, man habe so die Sache erfasst. Aber Dogen versuchte folgendes: Er hat ein großes Kapitel Uji geschrieben, das heißt auf Deutsch: Sein-Zeit. Es geht nicht darum, dass das Sein in der Zeit ist, oder dass die Zeit ist und dann wäre irgendwie Sein daneben, sondern das Sein ist Zeit. Es ist also nicht etwas als Etwas da, sondern alles ist Prozess, alles ist Bewegung, alles ist Werden. Diese Gedanken hat Wagner großartig im Tristan dargestellt, und auch seine Gedanken zur Inszenierung und Bühnenarchitektur bringen das zum Ausdruck. Hier lässt sich – ohne dass Wagner die Schriften des japanischen Meisters gekannt hätte - Dogen wiederfinden. Dogen hat im Japan des 13. Jhdts. einen Begriff für das Jetzt gebraucht, der die Dinge wirklich auf den Punkt bringt, und dieses Wort heißt im Japanischen kanno doko, in der deutschen Übersetzung bedeutet es kosmische Resonanz. Das heißt, dieses Jetzt ist eine Resonanz aller Erscheinungen der Wirklichkeit, und damit – wenn man so will – lässt sich die gesamte buddhistische Tradition auf einen Punkt, auf einen Erfahrungspunkt, bringen. Alles ist dem gesammelten, dem vorbereiteten, dem - man kann fast ein bisschen pathetisch sagen - nirwanischen Bewusstsein eine Resonanz von allem, eine kosmische Resonanz.
EMV: Sie haben jetzt gerade einen Begriff hineingebracht, nirwanisches Bewusstsein. Nirwana ist im populären Wortgebrauch bei uns das Nichts, das Auflösen im Nichts, das Nirgendwo. Nun gibt es einen klareren Begriff im Buddhismus, der dieses Nichts genauer beschreibt, nämlich die Shunyata, das ist die Leere, Leerheit. Im europäischen Denken ist ja die Angst vor der Leere, der horror vacui, geradezu ein Topos. Was bedeutet dieses Nichts, das der Buddhist so sehr erstrebt und wie verhält sich dazu die Angst, die wir im Westen vor dem Nichts, vor der Leere haben?
MVB: Das Ganze ist natürlich, wie das in der Sprache oft passiert und dann in Übersetzungen noch mehr, ein großes Missverständnis. Diese Shunyata, die Sie erwähnt haben, ist tatsächlich der buddhistische Ausdruck, vor allem im Mahayana-Buddhismus, der besonders in Ostasien seine Wirkung entfaltet hat. Dieses Nichts ist nicht wirklich Nichts, sondern Shunyata. Das übersetzen wir als Leerheit. Leerheit aber wird im indischen Buddhismus als wechselseitige Abhängigkeit aller Erscheinungen verstanden. Das heißt: Nichts ist, was es zu sein scheint. Es gibt kein unabhängiges Etwas, sondern alles ist, was es ist, in Wechselwirkung mit allem anderen. Und deshalb ist es leer, also shunya. Philosophisch lässt es sich so beschreiben: leer in Bezug auf inhärente Existenz. Das bedeutet also: Nichts ist in sich selbst etwas, sondern nur in Beziehung. Und das heißt nun: Jede Beziehung, jede Wechselwirkung, jede Relation, oder besser noch die Interrelation, ist das, was die Wirklichkeit ausmacht.
Und das könnte man wieder so wunderbar in Tonsprache übersetzen! Denn genau das ist letztendlich der Charakter der Melodie, sowohl im polyphonen als auch im homophonen Sinne. Und sprachgeschichtlich kommt das Wort shunya übrigens von der Sanskrit-Wurzel shvi, und diese Wurzel haben wir im Deutschen in dem Wort schwellen, denn die indogermanischen Sprachen sind ja miteinander urverwandt. Und diese Tatsache haben die Romantiker so wunderbar entdeckt, der Sprachwissenschaftler und Sanskritforscher Franz Bopp und natürlich Schopenhauer und Wagner, sie alle haben davon gezehrt. Die sprachliche Verwandtschaft von shvi und schwellen – das wird weder Schopenhauer noch Wagner bekannt gewesen sein. Aber diese Wurzel zeigt ja eine Bewegung an, und man könnte sagen, es steht sprachlich stellvertretend für ein Öffnen der Dinge für das Ganze. Und diese Bewegung ins Offene steckt ursprünglich in Shunyata. Dass der Westen diesen Begriff dann mit Nichtsübersetzt hat, hat natürlich seine Gründe: Der Begriff Nirwana bedeutet tatsächlich verwehen, aber was da verweht, das ist die Illusion, dass ein Ich oder irgendein Etwas unabhängig auf sich selbst gestellt existieren könnte. Stattdessen ist das, was uns als unabhängiges Ich erscheint, in Wirklichkeit ein Netz von Relationen. Und wenn der Mensch das erkennt, dann entwickelt er das, was nun für Schopenhauer und für Wagner so besonders wichtig war, nämlich die Barmherzigkeit, das Mitleid, das Erbarmen, denn man erkennt, dass das andere Lebewesen, und eben nicht nur der andere Mensch, sondern auch das andere Tier, in Wirklichkeit nicht etwas ganz anderes ist, sondern ein Spiegel, eine Resonanz dessen, was auch in mir ist. Und diese Erkenntnis erzeugt Mitleid und Erkenntnis, die mitleidende Erkenntnis, dass die Dinge zutiefst miteinander zusammenhängen. Denken Sie nur an Parsifal und den Schwan. Diese Geschichte hat Wagner ja mit gutem Grund erfunden, sie ist ursprünglich gar nicht in der Sage enthalten.
EMV: Dann wäre Parsifal quasi auch buddhistisch? Dieses Stück galt für mich immer als das christliche Musiktheaterstück Wagners.
MVB: Ja, ich glaube, dass ich Wagner hier gut nachempfinden kann – nicht nur, weil er gleichsam mein Schulkamerad ist (wir sind beide auf die Kreuzschule in Dresden gegangen), sonder weil hier eine christlich-buddhistische Synthese erreicht ist. Ich glaube, durch die buddhistische Praxis und durch die buddhistische Einsicht habe ich für mich tiefer verstehen gelernt, was das Christentum eigentlich meint. Und umgekehrt finde ich die Emotionen, die ich durch die christliche Praxis, besonders natürlich auch durch die Praxis der christlichen Musik, verinnerlicht habe, nun auch im Buddhismus. Diese Synthese von buddhistischen und christlichen Erfahrungen, die man eben auch bei Wagner, und hier ganz besonders auch im Parsifal findet, das ist es, was auch mein Leben wie ein Motor antreibt und zu immer neuen Erkenntnissen führt.
EMV: Wenn ich jetzt als westeuropäisch konditionierter Zuschauer so etwas ansehe, etwas wahrnehme, bräuchte ich da nicht mehr Erfahrung mit buddhistischer Lebensanschauung? Würde ich nicht etwas anderes wahrnehmen, wenn ich mehr darüber wissen würde?
MVB: Was Wagners Musik und Wagners Gesamtkunstwerk betrifft, und auch sein Verständnis dessen, sein Ausdruck dieses Verständnisses in seinen Werken, hierfür trifft das auf jeden Fall zu.
Aber um Wagner zunächst einmal rein dramatisch zu lesen, benötigt man keine buddhistische Brille. Wagners große Themen changieren ja ganz stark dualistisch zwischen Entsagung und Liebesglut, was ja im Parsifal ein Thema ist, aber natürlich auch im Tristan. Und das liest sich auch erst einmal als Widerspruch zur buddhistischen Philosophie. Aber die »zwei Seelen in der Brust« rühren natürlich auch daher, dass Wagner selbst ein ganz und gar europäischer Mensch war, und wir wissen ja von seiner Faszination für bestimmte Frauen, beispielsweise wie er selbst hin und her gerissen war in der Beziehung zu Mathilde Wesendonck. Diese Beziehung ist bekanntlich auch ein biografischer Hintergrund für den Tristan.
Aber ich vermute schon, und ich glaube das auch beweisen zu können anhand von Wagners eigenen Reflektionen zu dem Thema, vor allem auch anhand späterer Gespräche, die Cosima aufgezeichnet hat, dass er sich bewusst war, dass Tristans Entsagung nicht als eine Entsagung im Gegensatz zur erfüllten Liebe zu verstehen ist. Denn dann wäre auch Tristan wieder eine dualistische Geschichte, dann wäre Entsagung nur das Gegenteil zur Liebe, und das kennen wir ja aus der europäischen Tradition zu Genüge: die Entsagung ist immer auch die Verleugnung des Leiblichen. Und die Verleugnung des Leiblichen führt zu nichts, außer zu Verkrampfung und Verspannung. Wagner selbst hat das bitter erfahren und noch deutlicher und bis hin zum Wahnsinn hat es sein Freund Nietzsche erfahren. Und gegen diese dualistische Tradition des »entweder oder« haben ja alle aufbegehrt im 19. Jahrhundert. Unter der Einsicht der buddhistischen Nichtdualität wiederum erfährt das Mitleid, dieses Mitleiden, eine tiefere metaphysische Realisierung, und hier ist natürlich mitgedacht, dass das große Mitleiden, oder die Liebe, sich nicht im Geschlechtlichen erschöpfen kann, weil sie dort immer an ihre Grenzen stößt. Einfach deshalb, weil der Körper begrenzt ist. Aber auch die Seele ist begrenzt, die Fassungskraft ist begrenzt. Sie ist gerichtet auf eine menschliche Gestalt und die hat auch ihre eigenen Seiten und Schatten. Die große Sehnsucht, von der im Tristan die Rede ist, beschreibt, wenn man so will, nicht nur ein Drama über die Liebe, sondern über die Sehnsucht, die das Liebesgeschehen immer wieder antreibt. Von Anfang an und in allen Bildern, die Wagner entwirft, ist das zu sehen. Diese große Sehnsucht erschöpft sich nicht im Erreichen eines Zieles, sondern sie ist selbst der Motor, der über jedes Ziel hinausschießt. Und das ist es, was nun tatsächlich durch buddhistische Praxis und durch buddhistische Einsicht deutlich werden kann: dass das Nichterreichen eines Ziels nichts ist, was bedauerlich ist oder was den Menschen klein machen würde, sondern im Gegenteil, dass dieses ewige Sehnen gerade das ist, was die Welt in Bewegung hält.
EMV: Eine ganz entscheidende Praxis des Buddhismus ist die Meditation. Ist sie vergleichbar mit einem tiefen Gebet im Christentum?
MVB: Es kommt darauf an, was man unter Gebet versteht. Wir haben ja in der christlichen Tradition eine sehr vielfältige und ausdifferenzierte Gebetspraxis. Der christliche Glaube basiert sehr stark auf dem Vertrauen in den himmlischen Vater. Im Matthäus-Evangelium heißt es in Jesus Bergpredigt, dass die Christen ihren Gott nicht wegen jeder Kleinigkeit anrufen sollen, wie es die Heiden mit ihren vielen Göttern tun, sondern darauf vertrauen sollen, dass Gott sich um alles sorgt. Im 16. Jahrhundert entsteht dann durch Teresa von Avila eine spezifische christliche Gebetstradition, in der Stufen des Betens unterschieden werden: Im Bittgebet geht es darum, sich Gott als jemanden vorzustellen, der außen steht und zu dem man spricht wie zu einem anderen, zu einem höher stehenden Wesen, von dem man etwas erbittet. Allerdings geht es nicht darum, etwas von Gott zu bekommen, sondern ihn lediglich um Beistand zu bitten. »Herr, wenn ich nur Dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde«, heißt es in der Bibel. Und dann geht es so weiter, dass sich der Betende bewusst wird, dass es gar nicht Ich ist, der betet, sondern der Heilige Geist, also Gottes Kraft in mir. Das Ich verschwindet und es entsteht so etwas wie eine selbständige und allmählich alles andere überformende Präsenz des Geistes. Paulus hat es im Römerbrief Kap. 8 so beschrieben: »Nicht Ich bete, sondern der Geist Gottes betet in mir. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, sondern der Geist selbst ist es.« Johann Sebastian Bach hat das wunderbar vertont in seiner Motette Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Dieser christliche Grundgedanke kommt der buddhistischen Empfindung und der Meditation schon sehr nahe. »Es ist nicht Ich, der ich das mache«, das ist die Grundlage des Zen: Nicht Ich meditiere, ich fange zwar an und ich brauche einen Willen, um mich hinzusetzen, aber je mehr ich dann diesen Willen loslassen kann, je mehr ich mich hingebe – und das ist das Motiv der Hingabe und der Liebe – um so mehr erfasst mich die schöpferische Kraft des Geistes und führt mich in die Tiefen der Meditation. Und diese Erfahrungen, die dort gemacht werden, die lassen sich auch in Klängen ausdrücken, so wie Richard Wagner es im Tristan versucht hat.
EMV: Der Buddhismus ist im Moment sehr en vogue im Westen, in der westlichen Kultur, und tritt dort oft auch als Buddhismus light auf. Wie schätzen Sie das ein, oder warum glauben Sie, ist das so? Sehen Sie darin eine Gefahr für die eigentliche Kraft des Buddhismus oder sehen Sie eher eine Chance darin, dass er sich weiter verbreitet?
MVB: Also ich sehe darin grundsätzlich eine Chance. Aber diese Schattenseite der Buddhismus light – Pop-Kultur, die gibt es. Das ist ein Missverständnis oder gar Missbrauch des Buddhismus, vielleicht unvermeidlich in einer Gesellschaft, in der alles, aber auch alles vermarktet wird. Und wenn irgendetwas »in« ist und wenn irgendetwas die Menschen begeistert, dann kommen natürlich sofort Leute und versuchen damit ihre eigenen Geschäfte zu machen. Und so funktioniert die Buddhismus-Rezeption im Westen auch auf diese Weise, und es gibt sogar rückläufige Wirkungen dieses Buddha-Pop auf Japan, China und Thailand. Auch hier entstehen neo-buddhistische Bewegungen, die den Buddhismus als Wohlfühlreligion verkaufen. »Wenn du nur ein bisschen meditierst und Praxis übst, dann bist du erfolgreicher an der Börse, erfolgreicher bei den Frauen, ein bisschen glücklicher.« Wie töricht! Es wird ein vermeintliches Glücksversprechen im Buddhismus verkauft, aber der Buddhismus strebt nach einem anderen Glück, nach dem Glück des Loslassens nämlich. Die Praxis des Buddhismus verlangt viel Konzentration und Arbeit. Der Buddhismus ist in der Tat sehr anspruchsvoll.
Im Westen beginnt die Buddhismus-Rezeption nicht erst mit Schopenhauer und Wagner, sondern sie beginnt in der Aufklärung. Leibniz war von China begeistert, Voltaire war von Indien begeistert, da spielen buddhistische Elemente mit hinein, aber natürlich auch ein wenig Exotik. Aber daneben fließt heute eben auch buddhistische Spiritualität in unser modernes, wissenschaftliches Weltbild. Die Selbstkultivierung des Bewusstseins, die ihren Beginn in der Aufklärung hat, und auch die technische Entwicklung, deren Fortschritte unleugbar sind, führen zwar zu einem bestimmten modernisierten Lebensstandard, aber die psychische, die mentale Entwicklung des Menschen, die kommt nicht hinterher.
Deshalb, so scheint mir, ist die Begegnung mit dieser asiatischen Kultur tatsächlich eine große Chance. Ich möchte es mit Brecht sagen: »Wo die Not am größten, ist die Hilfe auch am nächsten.« Es ist die Chance, dass Menschen beginnen – sie haben auch schon lange begonnen, das will ich so nicht sagen – aber dass Menschen nun systematisch fortfahren, sich selbst zu kultivieren. Sich selbst kultivieren heißt, dass Bewusstsein zu kultivieren. Den Zusammenhang von Erkenntnis und Gefühl zu kultivieren, zu durchschauen und es nicht dem Zufall zu überlassen. Natürlich gibt es auch entsprechende Vorschläge in der griechischen Antike und in der mittelalterlichen Seelenkunde usw., aber der Buddhismus bietet doch Möglichkeiten und eine Praxis mit Präzision und langer Erfahrung an, die ihresgleichen nicht hat.
EMV: Sehen Sie die Gefahr eines Synkretismus?
MVB: Ich sehe keine Gefahr. Die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit, soweit wir sie kennen (und das ist wenig, wir überschauen nur einigermaßen etwa 4000 Jahre), sehe ich als eine Synthese, als ein Zusammenwachsen von verschiedenen Kulturen. Natürlich muss man unterscheiden: Es gibt sicherlich einen oberflächlichen Synkretismus, der alles zusammen mischt, wie in der Malerei, wenn man die falschen Farben miteinander mischt, dann entsteht ein hässliches Grau. Aber es gibt auch ein kluges, ein durch Erfahrung gesättigtes, ein selbst durchlittenes Zusammenbringen von Aspekten, und das ist die Kreativität des Lebens.
EMV: Das ist das schönste Schlusswort, was ich mir wünschen konnte. Lieber Herr von Brück, herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, wenn Sie am 3. Oktober unser Gast sein werden.
Michael von Brück: Geheimnis Mandala
Vortrag am 3. Oktober, 11 Uhr, in der Jahrhunderthalle Bochum